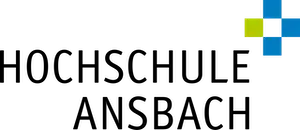Nicht jede Krankheit ist sofort erkennbar. Manche zeigen sich schleichend, in kleinen Abweichungen vom Gewohnten und bleiben dennoch lange unentdeckt. Besonders bei seltenen genetischen Erkrankungen stoßen Betroffene oft auf Unwissenheit, Unsicherheit und lange Wege zur Klarheit.
von Tayra Ünlü
Das KBG-Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung, die 1975 erstmals beschrieben wurde. Weltweit sind nur wenige hundert Fälle dokumentiert, die internationale KBG Fondation schätzt die Zahl auf unter 1.000 Betroffene. In Österreich gibt es bisher keine offiziellen Fallzahlen. Das Syndrom äußert sich durch vielfältige Symptome wie Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten und diverse körperliche Einschränkungen. Die Ursache ist eine Mutation im ANKRD11-Gen auf dem Chromosom 16. Dieses Gen ist entscheidend für die Genregulation und die Entwicklung des Körpergewebes. Eine Veränderung in diesem Bereich hat weitreichende Auswirkungen auf körperliche und geistige Funktionen. Die Vererbung erfolgt autosomal dominant, was bedeutet, dass Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sind. In den meisten Fällen tritt die Mutation spontan als Neumutation auf, ohne dass ein Elternteil Träger des defekten Gens ist. Die Symptome können von leichten geistigen Beeinträchtigungen wie ADS oder ADHS bis hin zu Autismus reichen. Körperliche Einschränkungen umfassen oft Skelettanomalien wie verzögertes Knochenaltern oder Verformungen, aber auch Herzfehler und Schwerhörigkeit. Die Schwere der Symptome variiert stark. Die Seltenheit des Syndroms stellt sowohl Diagnose als auch Versorgung vor große Herausforderung.
KBG-Syndrom bei einem Kind
Leo Schmidt (Name von der Redaktion geändert), 9 Jahre alt, wurde mit dem KBG-Syndrom diagnostiziert. Seine Mutter, Nora Schmidt (Name von der Redaktion geändert) die selbst Medizinerin ist, sprach von dem langwierigen Weg zur Diagnose: „Er hat nie geschaukelt, war motorisch ungeschickt und hat erst mit drei angefangen zu sprechen.“ Sie hatte früh das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Nach zahlreichen Therapien, pädagogischen Beratungen und Arztbesuchen wurde schließlich die endgültige Diagnose gestellt. Sie erinnerte sich: „Als der Anruf kam, dass es sich um das KBG-Syndrom handelt, war es wie eine Mischung aus Schock, Trauer, Bestätigung und Angst.“
Wir waren beim Ergotherapeuten, Logopäden und Psychotherapeuten. Niemand kam auf die Idee, eine genetische Untersuchung durchzuführen.“
Nora Schmidt
Medizinerin und Mutter eines von KBG betroffenen Kindes
Herausforderung bei Diagnosen und Behandlung
Eine schnelle und klare Diagnose des KBG-Syndroms ist schwierig, da viele Symptome unspezifisch sind und anderen Erkrankungen ähneln. Ärzte prüfen daher oft auf andere Krankheiten. Nora Schmidt berichtet: „Wir waren beim Ergotherapeuten, Logopäden und Psychotherapeuten. Niemand kam auf die Idee, eine genetische Untersuchung durchzuführen“. Erst als ein Kinderarzt nach einer möglichen Grunderkrankung fragte, kam die Diagnose heraus.
Fachkundige Beratung wichtig
Apotheker und Ärzte sind die wichtigsten Ansprechpartner. Sie weisen auf Therapieformen und Selbsthilfegruppen hin. Besonders bei seltenen Erkrankungen ist Sensibilität und gute Kommunikation entscheidend. Trotz hochwertiger Medizin in Österreich fällt das KBG-Syndrom durch das Raster. Humanmedizinische Institute sind oft nicht ausreichend informiert, psychologische Unterstützung fehlt. Nach einigen Telefonaten bei humangenetischen Praxen hörte ich oft denselben Satz „Ich habe davon noch nie gehört“.
KBG-Syndrom: Prävention und Engagement
Weltweit wird noch wenig zum KBG-Syndrom geforscht. Studien zur Genexpression und Symptomprogression sind selten, Behandlungsmöglichkeiten fehlen weitgehend. Daher ist eine primäre Prävention zur Verhinderung der Erkrankung nicht möglich. Der Fokus liegt auf frühzeitigem Engagement wie genetische Beratung und eine engmaschige Überwachung von Augen, Ohren, Wachstum und Entwicklung. Für Eltern bedeutet ein Kind mit dem KBG-Syndrom, ständige Wachsamkeit, emotionale Stabilität und organisatorisches Geschick. Je nach Symptom und Stärkegrad muss anders mit dem betroffenen Kind umgegangen werden, in Schulen sind Betreuer wie Schulbegleiter eine große Hilfe.
Dieser Artikel ist Teil einer Serie, die von Studierenden der Hochschule Ansbach für PharmaTime produziert wurde. Die Autorinnen und Autoren besuchen derzeit das Bachelorstudium Ressortjournalismus. Die Lehrredaktion leitete Journalismustrainer Markus Feigl aus St. Pölten.