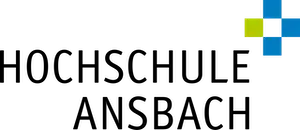Fieber, Hüftschmerzen, Auslandsreise: Was auf den ersten Blick harmlos klingt, entpuppte sich im Wiener Klinikalltag als seltener Fall von Brucellose. Auch wenn die Infektion in Österreich kaum vorkommt, sollten Apotheken bei unspezifischen Symptomen und der Reiseanamnese genau hinsehen.
von Annmarie Bertl
Die Brucellose wird durch Bakterien der Gattung Brucella ausgelöst. Hauptsächlich betroffen sind Nutztiere wie Schafe, Ziegen oder Rinder. Beim Menschen erfolgt die Ansteckung in der Regel durch den Verzehr nicht pasteurisierter Milchprodukte oder durch engen Kontakt mit infizierten Tieren.

Brucellosen sind meist importiert, etwa nach einem Auslandsaufenthalt in den Wochen oder bis zu zwei Monaten zuvor.
Dr. Nicole Harrison
klinische Infektiologin an der MedUni Wien
Laut Dr. Nicole Harrison, klinische Infektiologin an der MedUni Wien, ist die Erkrankung in Österreich zwar sehr selten, aber nicht ausgeschlossen: „Es handelt sich um weniger als einen Fall im Jahr an unserem Institut.“ Brucellosen seien zudem meist importiert, etwa nach einem Auslandsaufenthalt in den Wochen oder bis zu zwei Monaten zuvor.
Dr. Nicolas Königsreuther, Assistenzarzt im Wiener St. Anna Kinderspital, erinnert sich an den ersten Fall auf seiner Station: „Ein 14-jähriges Mädchen kam mit starken Schmerzen in der linken Hüfte zu uns. MRT und Labor zeigten eine Entzündung im Beckenbereich. Der Nachweis der Brucellose kam erst später durch Serologie und Blutkultur.“ Die Patientin war wenige Monate zuvor aus Syrien nach Österreich gekommen, einem Land mit hoher Brucellose-Prävalenz.
Diagnose und Therapie
„Die Symptome waren sehr unspezifisch, es war also ein Überraschungsbefund. Wir dachten auch an chronisch-entzündliche Darmerkrankungen“, so Königsreuther. Erst der Labornachweis brachte Klarheit. Die Therapie erfolgte mit einer Dreifach-Antibiotikakombination aus Doxycyclin, Rifampicin und Gentamicin. Aufgrund einer Rifampicin-Resistenz musste später umgestellt werden. „Die Behandlung dauert meist rund sechs Wochen“, fügt Königsreuther hinzu.
Dr. Harrison zu den laborlichen Untersuchungen: „Goldstandard ist der direkte Erregernachweis aus der Blutkultur oder aus Gewebeproben. Die Blutkultur wird in einem speziellen System bebrütet. Anschließend erfolgt die Identifikation mittels Bakterienkultur und Maldi-TOF. Zusätzlich stehen auch PCR-Tests zur Verfügung, die aus Blut oder Gewebe den Erreger nachweisen können.“
Langzeitfolgen
Laut Harrison stehe im Frühstadium der Erregernachweis aus dem Blut im Vordergrund, bei den selten aufkommenden chronischen Verläufen müsse hingegen je nach Fokus eine Gewebeprobe entnommen und etwa per PCR analysiert werden.
Unbehandelt oder zu kurz behandelt, kann der Verlauf chronisch werden. Typische Beschwerden wie Fieberschübe, Nachtschweiß oder Gelenkschmerzen können dann wiederholt auftreten. „Deshalb ist eine ausreichend lange Antibiotikatherapie entscheidend, um Rückfälle zu vermeiden“, so Königsreuther
Beratung
Laut Königsreuther könnten Fragen nach Herkunft oder vorherigem Aufenthalt, der Konsum nicht pasteurisierter Milchprodukte sowie passenden Symptomen wichtige Hinweise liefern. Dr. Harrison weist außerdem darauf hin, dass bei Verdacht unbedingt an eine Spezialambulanz verwiesen werden sollte.
Der Fall in Wien zeigt: Auch seltene Erkrankungen wie Brucellose können mitten im österreichischen Klinikalltag auftreten und erinnern daran, dass selbst seltene Diagnosen manchmal näher sind, als man denkt.
Brucellose vorbeugen
Brucellose ist in Österreich äußerst selten. Importierte Fälle treten jedoch nach Aufenthalten in endemischen Regionen wie dem Mittelmeerraum, dem Nahen Osten, Zentralasien oder Teilen Afrikas auf.
Zur Prävention sollte unbedingt auf Rohmilch sowie auf nicht pasteurisierte Milchprodukte, etwa Weichkäse aus Schafs- oder Ziegenmilch, verzichtet werden. Auch rohes oder nur unzureichend gegartes Fleisch kann ein Risiko darstellen. Der direkte Kontakt mit Nutztieren sollte ebenfalls vermieden werden. Da kein Impfstoff für den Menschen verfügbar ist, zählen Hygiene und eine bewusste Lebensmittelauswahl zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen. Apothekerinnen und Apotheker können durch Reiseberatung wertvolle Aufklärungsarbeit leisten.
Dieser Artikel ist Teil einer Serie, die von Studierenden der Hochschule Ansbach für PharmaTime produziert wurde. Die Autorinnen und Autoren besuchen derzeit das Bachelorstudium Ressortjournalismus. Die Lehrredaktion leitete Journalismustrainer Markus Feigl aus St. Pölten.